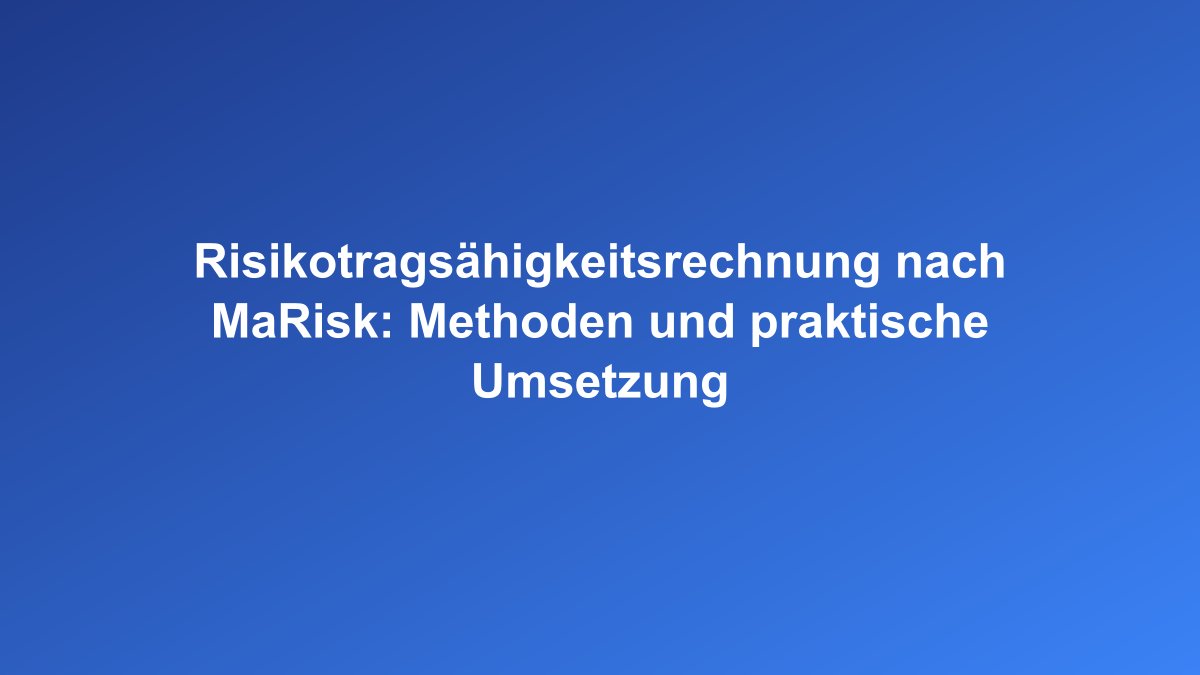
Risikotragsähigkeitsrechnung nach MaRisk: Methoden und praktische Umsetzung
Detaillierter Leitfaden zur Risikotragsähigkeitsrechnung für Banken: Barwert-, Periodenerfolgs- und Going-Concern-Ansatz nach MaRisk AT 4.1.
Einleitung
Die Risikotragsähigkeit (RiskBearing Capacity) ist ein Kernkonzept des MaRisk-Risikomanagements. Sie stellt sicher, dass Banken nur solche Risiken eingehen, die sie mit ihrem verfügbaren Risikokapital tragen können. Die BaFin verlangt eine regelmäßige, methodisch fundierte Risikotragsähigkeitsrechnung (RTF-Rechnung).
Konzeptionelle Grundlagen
Definition
Risikotragsähigkeit liegt vor, wenn:
- Die Risikodeckungsmasse (verfügbares Kapital) >= Risikodeckungsbedarf (aggregierte Risiken)
- Nach Eintritt aller modellierten Risiken das Institut überlebensfähig bleibt
- Regulatorische Mindestkapitalanforderungen jederzeit erfüllt sind
Regulatorische Anforderungen
MaRisk AT 4.1:
- Ermittlung der Risikodeckungsmasse
- Quantifizierung wesentlicher Risiken
- Aggregation der Risiken unter Berücksichtigung von Diversifikation
- Gegenüberstellung von Deckungsmasse und Risiken
- Stresstests und Szenarioanalysen
- Mindestens jährliche Durchführung
Perspektiven der Risikotragsähigkeit
Going-Concern-Perspektive
Ziel: Fortführung des Geschäftsbetriebs
Risikodeckungsmasse:
- Haftendes Eigenkapital (CET1, AT1)
- Stille Reserven (Bewertungsunterschiede)
- Nachrangige Verbindlichkeiten (teilweise)
- Minus regulatorische Mindestkapitalanforderungen
- Minus Puffer (Kapitalerhaltungs-, CCyB-Puffer)
Betrachtungshorizont: 1 Jahr
Gone-Concern-Perspektive (Liquidation)
Ziel: Ordnungsgemäße Abwicklung und Gläubigerschutz
Risikodeckungsmasse:
- Liquidationswert der Aktiva
- Stille Reserven vollständig
- Minus Verbindlichkeiten
Betrachtungshorizont: Abwicklungszeitraum (variabel)
Methoden der Risikotragsähigkeitsrechnung
1. Barwertansatz (präferiert)
Konzept:
- Bewertung zu beizulegenden Zeitwerten (Fair Value)
- Stille Reserven werden berücksichtigt
- Ökonomische Sichtweise
Risikodeckungsmasse:
RDM = Eigenkapital (buchmäßig)
+ Stille Reserven
+ Ergänzungskapital
- Immaterielle Vermögenswerte
- Regulatorische Abzugspositionen
- Mindestkapitalanforderungen (CET1 + Puffer)
Vorteile:
- Realitätsnähere Abbildung der Kapitalsituation
- Einbeziehung von Bewertungsreserven
- Frühzeitigere Risikosignale
Nachteile:
- Volatilität durch Marktwerte
- Komplexere Bewertung
- Datenqualität kritisch
2. Periodenerfolgsansatz
Konzept:
- Begrenzte Verlusttragfähigkeit im laufenden Geschäftsjahr
- Fokus auf GuV-Positionen
Risikodeckungsmasse:
RDM = Geplanter Jahresüberschuss
+ Risikovorsorge (Kreditrisiko)
+ Verwaltungsaufwand (reduzierbar)
+ Stille Reserven (realisierbar)
Anwendung:
- Ergänzend zum Barwertansatz
- Kurzfristige Steuerung
- Verknüpfung mit Budgetierung
Quantifizierung der Risiken
Wesentliche Risikoarten
| Risikoart | Messmethode | Konfidenzniveau | Betrachtungshorizont |
|---|---|---|---|
| Adressenausfall | Internal Ratings, Expected Loss | 99,9% | 1 Jahr |
| Marktpreis | Value-at-Risk, Sensitivitäten | 99,0% | 1 Jahr |
| Zinsänderung | Barwertänderung, Duration Gap | 99,0% | 1 Jahr |
| Liquidität | Liquidity-at-Risk | 99,0% | 1 Monat / 1 Jahr |
| Operationell | AMA, Standardansatz | 99,9% | 1 Jahr |
Value-at-Risk (VaR)
Definition: Der maximale Verlust, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) in einem definierten Zeitraum nicht überschritten wird.
Berechnung:
- Historische Simulation: Basierend auf vergangenen Preisbewegungen
- Varianz-Kovarianz-Ansatz: Normalverteilungsannahme
- Monte-Carlo-Simulation: Stochastische Modellierung
Kritik:
- Tail-Risiken werden unterschätzt
- Keine Aussage über Verlust im Extremfall
- Ergänzung durch Expected Shortfall (ES) empfohlen
Aggregation von Risiken
Diversifikationseffekte
Korrelationen zwischen Risikoarten:
- Adressrisiko vs. Marktrisiko: 0,3-0,5
- Zinsrisiko vs. Kreditrisiko: 0,4-0,7
- Operationelle Risiken: meist unkorreliert
Aggregationsformel (Varianz-Kovarianz):
Gesamt-VaR² = Σ VaR_i² + 2 * Σ Σ ρ_ij * VaR_i * VaR_j
Methoden:
- Einfache Addition: Konservativ, keine Diversifikation
- Korrelationsmatrix: Standard-Ansatz
- Copula-Ansätze: Komplexer, tail-dependencies
Herausforderungen
- Datenverfügbarkeit: Historische Korrelationen instabil
- Tail-Dependence: In Krisen brechen Diversifikationseffekte zusammen
- Modellrisiko: Fehlspezifikation der Abhängigkeiten
Stresstest und Szenarioanalysen
Reverse Stresstests
Konzept:
- Ausgangspunkt: Kapitalverzehr bis zur Insolvenz
- Rückwärts: Welche Szenarien führen dazu?
- Identifikation von Vulnerabilitäten
Nutzen:
- Extremrisiken identifizieren
- Diversifikationsillusion aufdecken
- Notfallplanung
Szenario-Analysen
Makroökonomische Szenarien:
- Basisszenario: Erwartete Entwicklung
- Stressszenario: Rezession, Zinsschock
- Extremszenario: Systemkrise, Pandemie
Bankenspezifische Szenarien:
- Ausfall größter Kreditnehmer
- Massenabhebungen (Bank Run)
- Cyber-Attacke
- Reputationsschaden
Limite und Steuerung
Limitstruktur
Gesamtbanklimit:
- Obergrenze für aggregierte Risiken
- Z.B. 80% der Risikodeckungsmasse
- Verbleibende 20% als Risikopuffer
Risikoartenlimite:
Beispiel für große Regionalbank:
- Kreditrisiko: 60% (größte Position)
- Zinsrisiko: 25%
- Marktpreisrisiko: 10%
- Operationelle Risiken: 5%
Summe vor Diversifikation: 100%
Nach Diversifikation: ~80%
Sub-Limite:
- Branchen (Kreditrisiko)
- Länder
- Laufzeitbänder (Zinsrisiko)
- Einzelgeschäfte
Eskalationsprozesse
Warnschwellen:
- Grün: < 70% Auslastung - Business as usual
- Gelb: 70-85% - Intensivierte Überwachung, Berichterstattung
- Orange: 85-95% - Genehmigungspflicht Geschäftsleitung
- Rot: > 95% - Neugeschäftsstopp, Risikoreduktion
Berichterstattung
Inhalte des RTF-Berichts
- Executive Summary
- Risikodeckungsmasse (Entwicklung, Zusammensetzung)
- Risikodeckungsbedarf (je Risikoart)
- Gegenüberstellung (Auslastungsgrade)
- Limitüberwachung
- Stresstestergebnisse
- Maßnahmen bei kritischen Auslastungen
Frequenz
- Geschäftsleitung: Monatlich
- Aufsichtsrat: Quartalsweise
- BaFin: Im Rahmen SREP / ICAAP (jährlich)
Integration mit ICAAP/ILAAP
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
Zusammenhang:
- RTF-Rechnung ist Kernstück des ICAAP
- ICAAP umfasst zusätzlich:
- Kapitalplanung (mehrjährig)
- Szenarioanalysen
- Verwendungsrechnung (Capital Allocation)
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
Liquidity-at-Risk:
- Analoges Konzept zur RTF für Liquidität
- Gegenüberstellung: Liquidity Buffer vs. Liquidity Stress
Praktische Umsetzung
Systemlandschaft
Anforderungen:
- Integration von Quelldaten (Core Banking, Treasury, Risk)
- Risikoaggregation in Echtzeit
- Simulationsfähigkeit (Szenarien)
- Reporting-Funktionalität
Anbieter:
- SAP Risk Management
- Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA)
- SAS Risk Management
- Moody's RiskFoundation
Datenqualität
Herausforderungen:
- Granularität der Daten (Einzelgeschäft vs. Portfolio)
- Konsistenz über Risikoarten hinweg
- Aktualität (Near-time für Limite)
Best Practices:
- Data Governance Framework
- Automatisierte Plausibilitätschecks
- Regelmäßige Datenqualitätsberichte
Fazit
Die Risikotragsähigkeitsrechnung ist unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Bankrisikomanagements. Sie erfordert methodisches Know-how, robuste IT-Systeme und hochqualitative Daten. Ein gut kalibriertes RTF-System schützt die Bank vor Überforderung, ermöglicht optimale Kapitalallokation und schafft Transparenz für Management und Aufsicht.
Verwandte Artikel
MaRisk-Grundlagen: Mindestanforderungen an das Risikomanagement für Banken
Detaillierter Überblick über die MaRisk der BaFin: Anforderungen an Governance, Risikomanagement und interne Kontrollsysteme deutscher Banken.
Kapitalplanung und ICAAP/ILAAP-Integration
Strategische Kapitalplanung: Integration von ICAAP und ILAAP in mehrjährige Kapital- und Liquiditätsprojektionen, Szenarioanalysen, Management-Actions und Kapitalallokation.
BAIT-Anforderungen: IT-Governance und Risikomanagement für Banken
Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT): Grundlagen, Struktur und praktische Umsetzung der BaFin-Vorgaben für Finanzinstitute.
