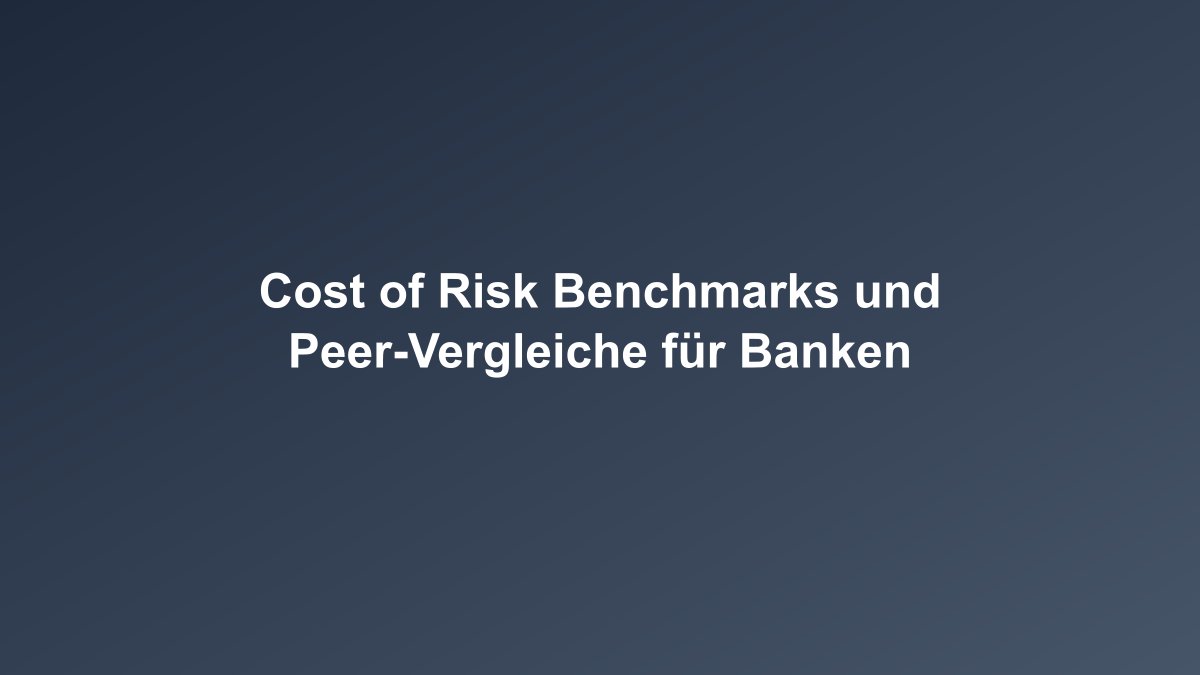
Cost of Risk Benchmarks und Peer-Vergleiche für Banken
Cost of Risk Benchmarks nach Bankentyp, internationale Vergleiche und regulatorische Erwartungen. Positionieren Sie Ihre Bank im Wettbewerbsumfeld.
Cost of Risk Benchmarks zeigen, wie gut eine Bank abschneidet.
Der Vergleich mit Peers offenbart Stärken und Schwächen. Er hilft bei strategischen Entscheidungen.
Für Aufsichtsbehörden, Investoren und Management ist die Einordnung im Wettbewerb unverzichtbar. Wer seine Position kennt, kann gezielt verbessern.
Branchenbenchmarks nach Bankentyp
Cost of Risk variiert stark nach Geschäftsmodell und Kundensegment.
Deutsche Banken lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen. Jede Gruppe zeigt typische CoR-Bandbreiten basierend auf Portfoliostruktur und Risikoappetit.
Sparkassen:
- Typischer CoR: 20-35 bps
- Charakteristik: Konservative Kreditvergabe, regionale Verankerung
- Portfolio: Überwiegend Retail und KMU, hohe Besicherungsquote
- Volatilität: Niedrig, geringe Schwankungen über Zyklen
- Besonderheiten: Gewährträger haftung (historisch), Regionalprinzip begrenzt Diversifikation
Genossenschaftsbanken:
- Typischer CoR: 25-40 bps
- Charakteristik: Mitgliederorientiert, stabiles Retailgeschäft
- Portfolio: KMU-lastig, landwirtschaftliche Kredite, Immobilienfinanzierung
- Volatilität: Niedrig bis mittel
- Besonderheiten: Sicherungssystem schützt vor Ausfällen, konservative Standards
Privatbanken und Landesbanken:
- Typischer CoR: 40-80 bps
- Charakteristik: Komplexe Portfolios, internationale Exposure
- Portfolio: Großkredite, Corporates, Structured Finance
- Volatilität: Hoch, stark zyklisch
- Besonderheiten: Höhere Risikobereitschaft, Legacy-Portfolios belasten
Direktbanken:
- Typischer CoR: 30-50 bps
- Charakteristik: Standardisierte Produkte, Score-basierte Vergabe
- Portfolio: Konsumentenkredite, Standardhypotheken
- Volatilität: Mittel
- Besonderheiten: Automatisierte Prozesse, wenig individuelle Bonitätsprüfung
| Bankentyp | Ø CoR (Normal) | CoR (Krise) | Haupttreiber |
|---|---|---|---|
| Sparkassen | 20-35 bps | 50-70 bps | Regionale Wirtschaft, KMU |
| Genossenschaftsbanken | 25-40 bps | 55-80 bps | Landwirtschaft, KMU |
| Privatbanken | 40-80 bps | 100-200 bps | Großkredite, International |
| Landesbanken | 50-90 bps | 150-250 bps | Structured Finance, Legacy |
| Direktbanken | 30-50 bps | 70-100 bps | Konsumentenkredite |
Die Unterschiede erklären sich durch Risikoappetit und Portfolio-Mix.
Sparkassen fokussieren auf besicherte Kredite und lokale KMU mit langjährigen Beziehungen. Privatbanken akzeptieren höhere Risiken für höhere Margen im Corporategeschäft. Direktbanken haben keine persönliche Kundenbeziehung, dafür standardisierte Prozesse.
Performance-Gruppen innerhalb der Segmente:
Auch innerhalb eines Segments gibt es erhebliche Unterschiede:
- Top-Quartil: 30-50% unter Segmentdurchschnitt
- Median: Benchmark-Wert
- Bottom-Quartil: 40-80% über Segmentdurchschnitt
Top-Performer zeichnen sich durch sophisticated Risk Management, Frühwarnsysteme und konsequentes Workout aus.
Internationaler Vergleich
Deutsche Banken schneiden im europäischen Vergleich gut ab.
Die historisch niedrigen CoR deutscher Institute spiegeln konservative Kreditkultur und stabile Wirtschaft wider. Südeuropäische Banken kämpfen mit Legacy-NPL und schwächeren Portfolios.
Europäischer CoR-Vergleich (Durchschnitt 2015-2023):
| Land/Region | Ø CoR | Hauptfaktoren |
|---|---|---|
| Deutschland | 30-45 bps | Konservativ, stabile Wirtschaft |
| Österreich | 35-50 bps | Ähnlich Deutschland, CEE-Exposure |
| Niederlande | 25-40 bps | Hohe Hypothekenqualität |
| Frankreich | 40-60 bps | Gemischt, Retailfokus |
| UK | 35-55 bps | Volatile, Brexit-Impact |
| Spanien | 70-120 bps | Immobilienkrise-Legacy |
| Italien | 80-150 bps | Hohe NPL, schwache Konjunktur |
| Griechenland | 150-300 bps | Krisenbehaftet, hohe NPL |
| Nordeuropa | 20-35 bps | Stabil, geringe Ausfälle |
Nordeuropäische Banken (Schweden, Norwegen, Dänemark) haben die niedrigsten CoR weltweit.
Ihre Portfolios sind hochqualitativ, Wirtschaft stabil und Kreditkultur konservativ. Griechische und italienische Banken kämpfen mit strukturellen Problemen aus der Eurokrise 2010-2015.
US-Banken zum Vergleich:
- US Regional Banks: 40-70 bps
- US Money Center Banks: 50-90 bps
- Besonderheit: Höhere Charge-Off-Raten aber schnellere NPL-Verwertung
US-Banken schreiben schneller ab als europäische. Das führt zu höheren kurzfristigen CoR, aber schnellerem Portfoliobereinigung.
Faktoren für internationale Unterschiede:
- Rechtssystem: Schnelle Verwertung (UK, Nordeuropa) vs. lange Verfahren (Italien, Spanien)
- Wirtschaftsstabilität: BIP-Wachstum, Arbeitslosigkeit
- Kreditkultur: Konservativ (Deutschland) vs. aggressive Vergabe (Spanien 2000-2008)
- Regulierung: Strenge Aufsicht (Deutschland, Nordeuropa) vs. laxere Standards (Südeuropa vor 2008)
- Sicherheitenrecht: Effektive Durchsetzung variiert stark
Deutsche Banken profitieren von stabilem Rechtsrahmen und konservativer Regulierung. Die BaFin setzt hohe Standards seit Jahrzehnten.
Konvergenz durch EZB-Aufsicht:
Seit SSM (Single Supervisory Mechanism) 2014 konvergieren Standards. Die EZB fordert:
- Einheitliche NPL-Definition
- Harmonisierte Provisioning-Standards
- NPL-Reduzierungspläne für Problembanken
- Vergleichbare Offenlegung
Das führt zu schrittweiser Angleichung. Südeuropäische Banken haben CoR reduziert, liegen aber noch deutlich über deutschen Werten.
Interpretation von Schwellenwerten
CoR-Schwellenwerte müssen im Kontext interpretiert werden.
Ein pauschaler Wert "gut" oder "schlecht" greift zu kurz. Geschäftsmodell, Konjunktur und Portfolio-Mix beeinflussen die Bewertung.
Grundlegende Schwellenwertlogik:
| CoR-Bereich | Bewertung | Typisch für | Aufsichtliche Reaktion |
|---|---|---|---|
| < 20 bps | Hervorragend | Top-Sparkassen, Nischen | Keine |
| 20-40 bps | Gut | Mainstream-Retail | Keine |
| 40-60 bps | Akzeptabel | Universalbanken, Mixed | Beobachtung |
| 60-100 bps | Erhöht | Problemportfolios, Krise | Intensive Aufsicht |
| > 100 bps | Kritisch | Krisensituation | Maßnahmen erforderlich |
Aber: Diese Werte müssen adjustiert werden.
Adjustierungen für Kontextfaktoren:
-
Geschäftsmodell-Adjustment:
- Retailbank: -10 bps
- Corporatebank: +15 bps
- Nischenbank (Private Banking): -15 bps
- International diversifiziert: +10 bps
-
Konjunktur-Adjustment:
- Boom-Phase: -10 bps Toleranz
- Normal: Benchmark
- Rezession: +30-50 bps Toleranz
- Strukturkrise: +50-100 bps kurzfristig toleriert
-
Portfolio-Quality-Adjustment:
- Besicherungsquote > 80%: -10 bps
- Hohe Branchen konzentration: +15 bps
- Viele Legacy-NPL: +20-40 bps
Beispiel-Interpretation:
Eine Landesbank mit 75 bps CoR in 2023:
- Basiswert: 75 bps
- Geschäftsmodell-Adjustment: +15 bps (Corporate-fokus)
- Konjunktur: Normal (keine Adjustment)
- Portfolio: +10 bps (Legacy-Exposure)
- Adjustiert: 75 - 25 = 50 bps effektiv
- Bewertung: Akzeptabel für das Geschäftsmodell
Ohne Kontext erscheint 75 bps erhöht. Mit Kontext ist es nachvollziehbar.
Dynamische Betrachtung ist entscheidend:
- Trend: Sinkende CoR besser als steigende
- Volatilität: Stabile CoR besser als schwankende
- Quartals-Anomalien: Einmaleffekte herausrechnen
Eine Bank mit steigenden CoR von 30 auf 50 bps verdient mehr Aufmerksamkeit als eine stabil bei 60 bps.
Peer-Analyse Methodik
Aussagekräftige Peer-Vergleiche erfordern Methodik und Sorgfalt.
Naive Vergleiche führen zu Fehlschlüssen. Sie müssen Äpfel mit Äpfeln vergleichen, nicht mit Birnen.
Schritte für robusten Peer-Vergleich:
1. Peer-Gruppe definieren:
- Ähnliches Geschäftsmodell (Retail vs. Corporate)
- Vergleichbare Größe (Bilanzsumme +/- 50%)
- Gleiche Region oder ähnliche Märkte
- Ähnliche Portfoliostruktur
2. Datenbasis harmonisieren:
- Gleiche Berechnungsmethodik sicherstellen
- IFRS 9 vs. lokale GAAP berücksichtigen
- Einmaleffekte herausrechnen (NPL-Verkäufe, Abspaltungen)
- Rollierende 12-Monats-Werte nutzen
3. Kontext-Faktoren berücksichtigen:
- Konjunkturelle Unterschiede (regionale Wirtschaftskraft)
- Rechnungslegungsunterschiede
- Aufsichtsregime
- Geschäftsmodell-Nuancen
4. Mehrjahres-Perspektive einnehmen:
- Mindestens 3-5 Jahre analysieren
- Volle Konjunkturzyklen abdecken
- Trendentwicklung wichtiger als Punktwerte
5. Quartils-Analyse durchführen:
- Top-Quartil, Median, Bottom-Quartil identifizieren
- Eigene Position einordnen
- Abstand zu Median und Best-Practice messen
Praktisches Beispiel:
Sie analysieren eine regionale Sparkasse mit 35 bps CoR:
- Peer-Gruppe: 15 vergleichbare Sparkassen (Bilanzsumme 5-15 Mrd. €)
- Datenbasis: IFRS 9, rollierende 12 Monate, 2020-2024
- Ergebnis:
- Top-Quartil: < 25 bps
- Median: 32 bps
- Bottom-Quartil: > 45 bps
- Einordnung: Leicht über Median, deutlich unter Bottom-Quartil
- Bewertung: Solide, aber Verbesserungspotenzial zu Top-Quartil
Zu vermeidende Fehler:
- Vergleich mit international tätigen Großbanken
- Ignorieren von Einmaleffekten (Verkäufe, Restrukturierungen)
- Nur Jahresenddaten nutzen (kann verzerrt sein)
- Unterschiedliche Rechnungslegung nicht berücksichtigen
- Kurzfristige Ausreißer überinterpretieren
Datenquellen für Peer-Vergleiche:
- Offenlegungsberichte (Säule 3)
- EBA Transparency Exercise
- Geschäftsberichte
- BaFin Statistiken
- Bloomberg / S&P Datenbanken
Die EBA veröffentlicht halbjährlich Risk Dashboard mit aggregierten Benchmarks für significant institutions.
Regulatorische Erwartungen
Die Aufsicht hat klare Erwartungen an Cost of Risk.
Die EZB als SSM-Aufsicht überwacht CoR-Entwicklung intensiv. Dauerhaft hohe Werte triggern aufsichtsrechtliche Maßnahmen.
EZB-Erwartungen im SREP:
Der Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) bewertet Risiken vierteljährlich:
- Score 1 (Low Risk): CoR < 40 bps, stabil, robust gesteuert
- Score 2 (Medium-Low): CoR 40-60 bps, überwacht, akzeptabel
- Score 3 (Medium-High): CoR 60-100 bps, erhöhte Aufmerksamkeit
- Score 4 (High Risk): CoR > 100 bps, intensive Aufsicht, Maßnahmen
Ein SREP-Score 3 oder 4 für Kreditrisiko führt zu:
- Höheren Säule 2 Kapitalpuffern (P2R)
- Quartalsweisen Risk Committee Meetings mit Aufsicht
- Verpflichtung zu Risikoreduktionsplan
- Einschränkungen bei Dividenden
NPL-Guidance und CoR:
Die EZB NPL-Guidance von 2017 erwartet:
- Abbaupläne für NPL-Quoten > 5%
- Provisions auf neue NPL innerhalb 2 Jahren (unsichert) bzw. 7 Jahren (besichert)
- Dies treibt CoR kurzfristig nach oben
Banken mit hohen NPL-Beständen müssen aggressive Provisions bilden. Das erhöht CoR temporär, reduziert aber langfristig Risiko.
BaFin-Anforderungen:
Die BaFin ergänzt EZB-Aufsicht für Less Significant Institutions:
- Mindestanforderungen an Risikomanagement (MaRisk)
- Erwartung robuster Frühwarnsysteme
- Angemessene Dotierung der Risikovorsorge
- Stresstests müssen CoR-Anstiege abbilden
Kapitalauswirkungen hoher CoR:
Dauerhaft hohe CoR signalisieren Risikomodellschwächen. Die Aufsicht kann reagieren mit:
- Multiplier auf RWA: +10-25% für riskante Portfolios
- P2R-Zuschläge: 0,5-2,0% zusätzliches Kapital
- P2G (Guidance): Nicht rechtsverbindlich aber faktisch Mindestanforderung
Eine Bank mit strukturell 120 bps CoR zahlt 1-2% mehr Eigenkapital. Bei 10 Mrd. € RWA sind das 100-200 Mio. € gebundenes Kapital.
Forward-Looking-Expectations:
Die EZB fordert seit 2020 stärkere Forward-Looking-Komponente:
- Stress-CoR in adverse Szenarien offenlegen
- Makro-Szenarien realistisch kalibrieren
- Management Overlays transparent dokumentieren
- Vorsorgliche Dotierung in guten Zeiten
Banken, die nur reagieren statt proaktiv zu provisonieren, erhalten schlechtere SREP-Scores.
Best Practice aus Aufsichtssicht:
- CoR langfristig unter 60 bps halten
- Volatilität durch antizyklische Provisions dämpfen
- Sophisticated Risk Management nachweisen
- Transparente Offenlegung und Erklärung
- Proaktives Problemkreditmanagement
Banken mit diesen Charakteristika erhalten Score 1 oder 2 und minimale Kapitalpuffer.
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Artikel
Cost of Risk Definition und Berechnung für Banken
Cost of Risk misst die Kreditrisikovorsorge in Basispunkten. Erfahren Sie Definition, Berechnungsformel und praktische Anwendung für Ihr Risikomanagement.
Cost of Risk Treiber und Konjunkturzyklen verstehen
Erfahren Sie, welche Faktoren Cost of Risk beeinflussen und wie Risikokosten im Konjunkturzyklus schwanken. Strategische Steuerung für Ihr Risikomanagement.
EZB-Klimastresstest - NGFS-Szenarien und Methodik für Banken
Detaillierte Analyse des EZB-Klimastresstests, NGFS-Szenarien, Durchführungsmethodik, Ergebnisse 2022 und praktische Umsetzung
