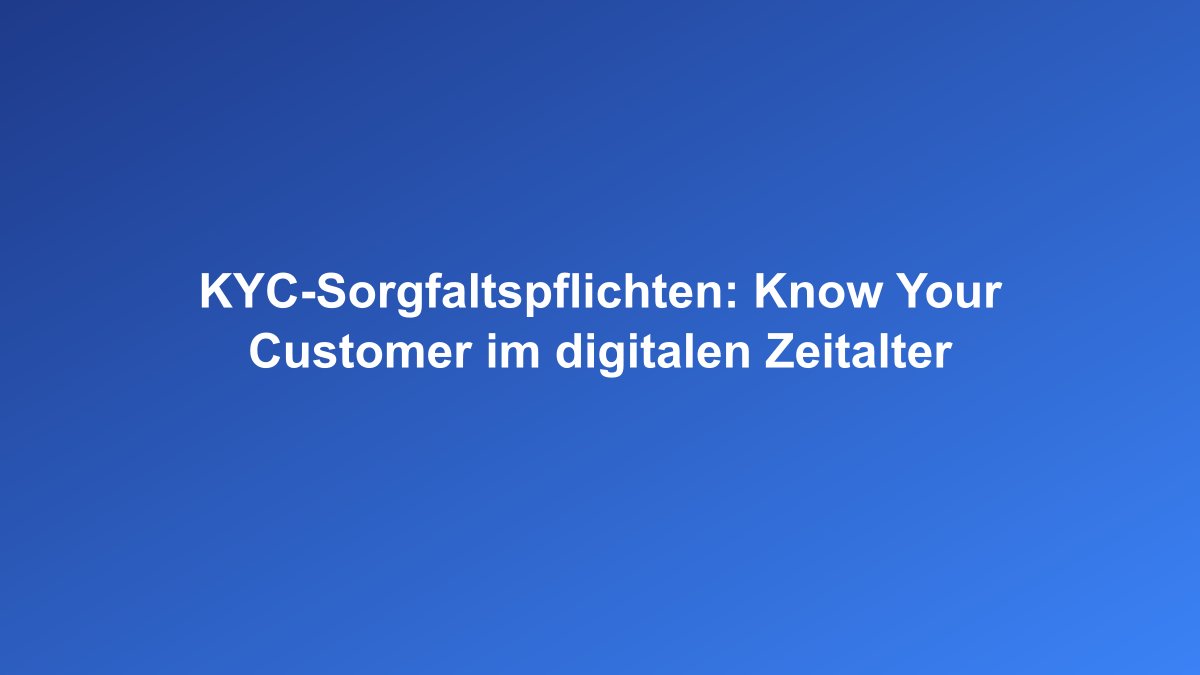
KYC-Sorgfaltspflichten: Know Your Customer im digitalen Zeitalter
Detaillierter Leitfaden zu KYC-Prozessen, Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und digitalen Onboarding-Verfahren nach GwG-Vorgaben.
Einleitung
Know Your Customer (KYC) ist das Fundament jeder Geschäftsbeziehung im Bankwesen. Die Sorgfaltspflichten nach § 10 ff. GwG verpflichten Institute zur Identifizierung und Überprüfung aller Kunden sowie zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten.
Stufen der Sorgfaltspflichten
Vereinfachte Sorgfaltspflichten (§ 14 GwG)
Anwendungsbereich:
- Kreditinstitute, die der CRR unterliegen
- Börsennotierte Unternehmen (regulierter Markt)
- Öffentliche Stellen innerhalb der EU
Maßnahmen:
- Reduzierte Identifizierungspflichten
- Vereinfachte Dokumentation
- Risikobasierte Überwachung
Allgemeine Sorgfaltspflichten (§ 10 GwG)
Pflichtbestandteile:
- Identifizierung des Vertragspartners
- Überprüfung der Identität
- Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
- Einholung von Informationen über Zweck und Art der Geschäftsbeziehung
- Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung
Verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15 GwG)
Auslöser:
- Politisch exponierte Personen (PEPs)
- Korrespondenzbeziehungen mit Drittstaaten
- Hochrisikoländer (FATF-Liste)
- Transaktionen über 10.000 Euro in bar
- Komplexe Unternehmensstrukturen
Identifizierungsverfahren
Natürliche Personen
Erforderliche Angaben:
- Vor- und Nachname
- Geburtsort und -datum
- Staatsangehörigkeit
- Wohnanschrift
Zulässige Dokumente:
- Personalausweis
- Reisepass mit Meldebestätigung
- Elektronischer Aufenthaltstitel
Juristische Personen
Erforderliche Informationen:
- Firma, Name oder Bezeichnung
- Rechtsform
- Registernummer
- Anschrift des Sitzes/Hauptniederlassung
- Namen der Vertretungsberechtigten
Nachweisdokumente:
- Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Gründungsurkunde
- Gewerbeanmeldung
Wirtschaftlich Berechtigter
Definition nach GwG
§ 3 GwG definiert wirtschaftlich Berechtigte als:
- Natürliche Personen, die mehr als 25% der Kapitalanteile halten
- Natürliche Personen, die mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren
- Natürliche Personen, die auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben
Ermittlungsmethodik
Stufenansatz:
| Stufe | Methode | Schwellenwert |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Direkte Beteiligung | > 25% Kapital/Stimmrechte |
| Stufe 2 | Indirekte Beteiligung | Beherrschung über Zwischengesellschaften |
| Stufe 3 | Kontrolle durch Vereinbarung | Faktische Beherrschung |
| Stufe 4 | Gesetzlicher Vertreter | Falls keine Person identifizierbar |
Transparenzregister
Seit August 2021 besteht eine Pflicht zur Eintragung wirtschaftlich Berechtigter im Transparenzregister.
Besonderheiten:
- Vollregister (keine Mitteilungsfiktion mehr)
- Elektronischer Abruf durch Verpflichtete
- Bußgelder bei Nichtmeldung bis 150.000 Euro
Digitale Identifizierung
Video-Identifizierung (§ 12 GwG)
Voraussetzungen:
- Qualifizierte Videokommunikation in Echtzeit
- Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments
- Sicherheitsmerkmale müssen erkennbar sein
- Aufzeichnung und Speicherung für 5 Jahre
Prozessschritte:
- Videoverbindung zum Identifizierungsdienstleister
- Ausweisprüfung (Sicherheitsmerkmale, Hologramme)
- Abgleich mit Live-Bild (Liveness-Check)
- Dokumentation und Aufzeichnung
eID-Funktion (Online-Ausweisfunktion)
Vorteile:
- Vollautomatisierter Prozess
- Höchste Sicherheitsstandards
- Sofortige Identifizierung
- Kosteneffizienz
Herausforderungen:
- Geringe Aktivierungsrate (ca. 15%)
- Technische Hürden (NFC-fähiges Smartphone erforderlich)
- Nutzerakzeptanz
Künstliche Intelligenz
KI-gestützte Verfahren:
- Automatisierte Dokumentenprüfung
- Gesichtserkennung und Biometrie
- Betrugserkennung (Deepfakes)
- Kontinuierliches Screening
Kontinuierliche Überwachung
Transaktionsmonitoring
Überwachungskriterien:
- Transaktionsvolumen im Verhältnis zum Kundenprofil
- Geografische Anomalien
- Strukturierung von Zahlungen
- Abweichungen vom erwarteten Geschäftszweck
Aktualisierungspflichten
Aktualisierungsintervalle:
- Geringes Risiko: Alle 5-7 Jahre
- Normales Risiko: Alle 3-5 Jahre
- Erhöhtes Risiko: Jährlich oder bei Verdachtsmomenten
- PEPs: Mindestens jährlich
PEP-Screening
Definition politisch exponierter Personen
Kategorien:
-
PEPs mit wichtigen öffentlichen Ämtern
- Regierungsmitglieder
- Parlamentarier
- Richter an obersten Gerichten
- Militärische Führungskräfte
-
Familienmitglieder
- Ehepartner, Partner
- Kinder und deren Ehepartner
-
Bekanntermaßen nahestehende Personen
- Wirtschaftliche Verflechtungen
- Gemeinsame wirtschaftliche Interessen
Screening-Prozess
Maßnahmen bei PEP-Identifikation:
- Zustimmung der Geschäftsleitung zur Aufnahme
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Kontinuierliche intensivierte Überwachung
- Ermittlung der Vermögensherkunft
- Erhöhte Dokumentationspflichten
Technologie und Tools
Screening-Datenbanken
Kommerzielle Anbieter:
- World-Check (Refinitiv)
- Dow Jones Risk & Compliance
- LexisNexis Bridger Insight
- Compliance Catalyst
Abdeckung:
- PEP-Datenbanken (global)
- Sanktionslisten (UN, EU, OFAC)
- Negative Medienberichte
- Adverse Media Screening
RegTech-Lösungen
Funktionalitäten:
- Automatisierte Risikoklassifizierung
- KI-basiertes Transaktionsmonitoring
- Workflow-Management für KYC-Prozesse
- Reporting und Audit-Trail
Herausforderungen und Best Practices
Datenschutz vs. Compliance
DSGVO-Anforderungen:
- Datensparsamkeit bei Datenerhebung
- Zweckbindung der Verarbeitung
- Informationspflichten gegenüber Betroffenen
- Löschfristen (vs. 5-jährige Aufbewahrungspflicht GwG)
Lösungsansatz:
- Privacy by Design
- Differenzierte Aufbewahrungskonzepte
- Rechtsgrundlagen sauber dokumentieren
Effizienz vs. Sorgfalt
Optimierungsansätze:
- Risikobasierte Automatisierung
- Digitale Identifizierung für Standardfälle
- Manuelle Prüfung bei Hochrisikokunden
- Qualitätssicherung durch Stichproben
Fazit
KYC-Sorgfaltspflichten sind unverzichtbarer Bestandteil des modernen Banking. Die Balance zwischen regulatorischen Anforderungen, Kundenerlebnis und operativer Effizienz erfordert intelligente Prozesse, moderne Technologie und gut geschultes Personal. Digitale Lösungen bieten Potenzial zur Optimierung, ersetzen jedoch nicht die risikobasierte Einzelfallprüfung bei komplexen Strukturen.
Verwandte Artikel
Grundlagen der Geldwäschebekämpfung: AML-Anforderungen für deutsche Banken
Umfassender Überblick über Anti-Geldwäsche-Vorschriften in Deutschland: Gesetzliche Grundlagen, BaFin-Anforderungen und praktische Umsetzung.
6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD): Neue Anforderungen für deutsche Banken
Umfassender Überblick über die 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Erweiterte Straftatbestände, strafrechtliche Verantwortlichkeit und Umsetzung in Deutschland.
Sanktionslisten-Screening: Compliance mit internationalen Finanzsanktionen
Praktischer Leitfaden zum Screening von Sanktionslisten (UN, EU, OFAC): Prozesse, Technologien und rechtliche Anforderungen für Banken.
